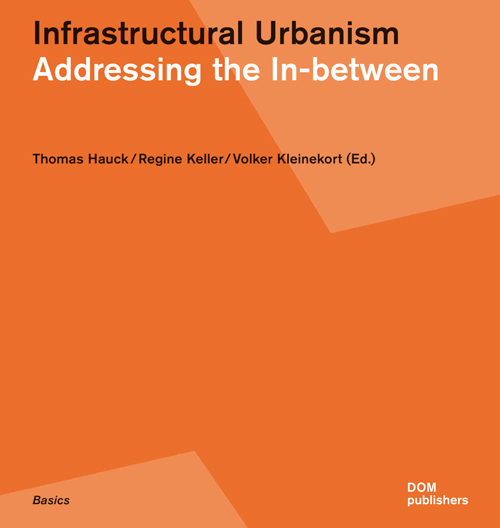Unausgeschöpfte Potenziale
Christian Holl
18. April 2012
Eigentlich ist es erstaunlich: Ende 2011 erscheint ein Buch, das sich, aufbauend auf einer Anfang 2010 durchgeführten Tagung, mit der Bedeutung der Infrastruktur für Städtebau, Stadt- und Landschaftsplanung beschäftigt. - Bücher über neue Sichtweisen der Stadt.
Eigentlich ist es erstaunlich: Ende 2011 erscheint ein Buch, das sich, aufbauend auf einer Anfang 2010 durchgeführten Tagung, mit der Bedeutung der Infrastruktur für Städtebau, Stadt- und Landschaftsplanung beschäftigt. Man ist geneigt, dies für eine tautologische Themenstellung zu halten, denn wie sollte eine Stadt ohne ihre Infrastruktur überhaupt gedacht werden können? Und trotzdem sind die in "Infrastructural Urbanism" aufgeworfenen Fragen, ob städtische Infrastruktur Potenziale bietet, die nicht genutzt werden, vollkommen berechtigt. Die Beiträge zeigen, dass die Praxis der Stadt ganz offensichtlich an gewaltige Verdrängungsleistungen geknüpft ist. Hegemoniale Stadtvorstellungen als Idealbilder gelingenden Lebens verdrängen die Bedingungen, unter denen solche Stadtvorstellungen sich verwirklichen lassen – aber Stadt erschöpft sich eben nicht in solchen Bildern. Im Buch werden Beiträge, die die geschichtliche Dimension städtischer Infrastruktur aufarbeiten mit Texten kombiniert, die auf das informelle Potenzial der Räume verweisen, welche als Nebenprodukt insbesondere von Verkehrstrassen entstehen. Theoretische Überlegungen werden durch Fallbeispiele aus Europa und Amerika anschaulich gemacht, die landschaftliche Dimension ebenso einbezogen wie die künstlerische.
Auch in "Urban Reset" wird postuliert, "Verkehrsinfrastrukturen" stellten "eine bis heute viel zu wenig genutzte Ressource der Stadtentwicklung dar." Auch dieser Band ist auf der Basis einer Tagung entstanden. Den Herausgebern geht es dabei um das "Freilegen immanenter Potenziale städtischer Räume". Dabei wird dem Begriff der Kreativität eine maßgebliche Rolle eingeräumt – auch von der städtebaulichen Kreativität wird behauptet, sie sei eine wenig beachtete Ressource der Stadtentwicklung. Und auch hier werden reflektierende Positionen durch Fallbeispiele, in diesem Fall auf den westeuropäischen Kontext beschränkt, ergänzt. Sowohl theoretisch als auch praktisch wird gering geschätzten Qualitäten existierender Stadträume nachgespürt und nach den Bedingungen gefragt, um diese Qualitäten für die stadtplanerische Praxis nutzbar zu machen. Die Herausgeber machen Differenz als maßgebliches Kriterium für eine fruchtbare Neuprogrammierung bestehender städtischer Areale aus: Differenz zum Bestehenden, Differenz zum jeweiligen Umfeld und Differenz zu konventionellen Herangehensweisen. Dass die Herausgeber den Titel ihres Buches nun in alberner Marketingschreibweise als "urbanRESET" wie eine Marke in der abschließenden Bilanz anpreisen, als handle es sich dabei um eine neue Methodik oder einen Instrumentenkasten für eine zeitgemäße Stadtplanung, macht zumindest misstrauisch. Eine solche diskursive Strategie ist Element dessen, was die Diskussion, die im Buch entfaltet wird, eigentlich hinterfragen will: einen Umgang mit der Stadt, der verhindert, dass man ihrer Komplexität gerecht wird.
Wie wirkungsmächtig Reduzierungen in einer diskursiven Praxis die Realität der Stadtplanung tatsächlich beeinflussen, zeigt "The Heart of the City". Die Autorin geht darin dem CIAM-Kongress von 1951 und dessen Vorgeschichte nach, relativiert und korrigiert damit die Vorstellungen, die man sich vom CIAM bis heute macht. Das Buch ist ein auf der Basis vieler bislang nicht berücksichtigter Quellen entstandener, fundierter und gut zu lesender Forschungsbericht. Schon lange vor 1951 hatten sich in den Diskussionen die Vertreter des CIAM von deterministischen oder rein funktionalistischen Stadtvorstellungen gelöst. Der Kongress von 1951 hatte das Zentrum der Stadt als kommunikativen Ort ihrer Bewohner ausgemacht, an dem er sich als Teil einer Gemeinschaft erleben kann. Die planerische Behandlung des Herzens der Stadt lag folgerichtig im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen. Dynamik und Wandel, Informalität sowie ein Wechselspiel konstanter und variabler Elemente waren als wichtige Parameter des städtischen Systems erkannt worden. Der spätere, reduzierende Rückblick auf den CIAM sollte Raum für neue Sichtweisen schaffen, verhinderte aber auch, dass die Ergebnisse der CIAM-Arbeit wirken konnten. Das Buch schließt damit, dass durch diesen bewusst herbeigeführten Bruch wesentliche Erkenntnisse der CIAM bis heute nicht verfügbar seien. Es sind also auch unausgeschöpfte Potenziale dort auszumachen, wo man sie nicht unbedingt vermutet hatte.
Verwandte Artikel
-
Student und noch kein Zimmer?
20.11.13
-
Anything goes
13.11.13
-
Wir können nur spekulieren
30.10.13
-
Leserreaktion
30.10.13